Beratungspsychologie – zwischen den Zeilen
Vor allem Ärzte, aber auch Apotheker werden viel dafür gescholten, unverständlich mit Patienten zu kommunizieren, Fachchinesisch zu reden oder sich nicht genug Zeit zu nehmen. Doch auch umgekehrt gilt: Die Kommunikation vieler Patienten ist verbesserungsfähig. Die Psychologin Kirsten Khaschei beschäftigt sich seit langem mit Gesprächsführung zwischen Patienten und Heilberuflern. Zuletzt hat sie der Frage, worauf Patienten im Arztgespräch achten sollten, ein ganzes Buch gewidmet. Im Gespräch erklärt sie, worauf Apotheker und PTA beim Umgang mit Patienten und Kunden achten sollten.
„Arztgespräche richtig führen – So mache ich mich verständlich“ ist gerade im Dudenverlag erschienen. „Auf beiden Seiten besteht ein großes Bedürfnis nach hilfreichen und klärenden Gesprächen – egal, ob es dabei in der Hausarztpraxis um Medikamente gegen Magenbeschwerden geht oder im Krankenhaus um die Narkose vor einer geplanten Operation“, schreibt Khaschei. Die Patienten bewegen sich dabei oft auf einem schmalen Grat zwischen Eigenverantwortung und Überforderung.
„Es handelt sich bei Gesprächen mit Ärzten und Apothekern gleichermaßen meist um eine Situation, in der ein angeschlagener Mensch Hilfe sucht. Und kranke Menschen zeichnet oft ein großes Informationsbedürfnis aus“, erklärt sie im Gespräch. „Gleichzeitig haben die Patienten teilweise nur ein geringes Gesundheitswissen. Das gilt es zu beachten.“ Da man einem Patienten, den man nicht kennt, nicht auf Anhieb ansehen kann, wie fundiert sein Wissen ist, sei es ratsam, stets „dessen Informationsbedürfnis zu spiegeln“, wie Khaschei es ausdrückt. Konkret heißt das vor allem, den Patienten nicht einfach zu belehren, sondern ihn dazu zu motivieren, Nachfragen zu stellen. Nicht nur kann er sich seine Informationen dann selbst nach Bedarf einholen, er gibt dem Apotheker damit auch Anhaltspunkte über den Grad seines eigenen Vorwissens.
„Nutzerfreundliche Kommuniktation“, nennt Khaschei das. „Man darf sich nicht hinstellen und sagen: ‚Ich bin hier, schau mal, was ich alles weiß.“ Ein weiterer psychologischer Mechanismus spielt dabei ebenfalls eine Rolle: „Wenn ich etwas einfach nur herunterspule, gebe ich dem Patienten unterbewusst das Gefühl, dass die Informationen nicht so wichtig wären.“
Doch auch ein ganz praktischer Aspekt spricht für die Animation zum Nachfragen: „Die Apotheke ist ja oft die Schnittstelle zwischen der Arztpraxis und dem Heimweg“, erzählt Khaschei. „Je nach dem, was ich gerade beim Arzt erfahren habe, bin ich als Patient mehr oder weniger zerstreut, besorgt oder aufgeregt. Nachfragen zu wichtigen Informationen werden dann oft vergessen.“ Deshalb müsse auch da der Apotheker tätig werden und eventuell etwas nachhelfen. „Ein gutes Gespräch ist immer ein Gemeinschaftswerk“, sagt die Diplom-Psychologin.
Doch nicht nur die Informationen sind im Gespräch mit dem Patienten zentral, auch die richtige Gesprächsatmosphäre spielt eine entscheidende Rolle. „Gesundheit und Krankheit zählen immer zum Intimbereich des Menschen.“ Es sei deshalb wichtig, Ruhe herzustellen, aber auch Wertschätzung zu zeigen. Um dem Patienten zu vermitteln, dass man sich genug Zeit für ihn nimmt, muss man aber nicht zwangsläufig länger mit ihm reden. „Es ist viel wichtiger, von einem funktionalistischen Gesundheitsbegriff wegzukommen, also nicht nur Informations-Ping-Pong zu spielen, sondern dem Gegenüber auch das Gefühl zu vermitteln, das sich jemand Zeit für ihn nimmt und er erzählen kann, wie es ihm wirklich geht.“ Das kann man zum Teil schon mit einfachen Mitteln erreichen: langsam sprechen, den Patienten nicht unterbrechen, sondern immer aussprechen lassen und dabei stets einen freundlichen Blickkontakt halten, statt nebenbei schon die Rezeptdaten einzutippen. „Das führt zu einer Entschleunigung, die schon an sich gesund ist, und sorgt dafür, dass die Wahrnehmung der Person spürbarer wird.“
Wer sich so auf den Patienten konzentriert, hat auch bessere Chancen, sich auf dessen Situation einzustellen. Denn woher er mit welchem Leiden kommt, ist natürlich auch von Bedeutung. „Generell kann man eigentlich sagen, je spezialisierter ein Arzt ist, desto höher ist die Chance, dass sein Blick für den Menschen hinter der Medizin verschwindet. Dann bin ich eben nur noch das kaputte Knie oder die ausgewechselte Hüfte für den Arzt“, sagt Khaschei. „Da können Apotheken ausgleichend wirken. Wenn ich sehe, dass jemand ein hoch spezifisches Medikament kriegt, kann ich versuchen, den ganzen Menschen zu sehen und ihm zu ermöglichen, sein Gesamtbefinden zu erklären.“
Dabei sollte man nicht denselben Fehler machen wie viele Ärzte: Nur den Patienten mit seiner Indikation und Medikation zu sehen, sondern auch dessen Charakter miteinbeziehen – denn auch der kann wesentlichen Einfluss haben. Jeder kennt die stereotypischen Extreme: Der Hypochonder, der beim kleinsten Kopfschmerz Angst vor einem Hirntumor hat, und der harte Kerl, der schon Blut hustet, aber immer noch sagt, das sei alles halb so schlimm. Dazwischen gibt es unendlich viele Abstufungen, die es zu erkennen gilt, damit man sich auf sie einstellen kann.
Denn manchmal gilt es auch, den Patienten behutsam von etwas zu überzeugen – wenn er beispielsweise nicht viel auf die Notwendigkeit seiner Medikation und der dazugehörigen Beratung hält. Dann könne man auch einmal sagen wie: „Ich habe den Eindruck, Sie möchten das gar nicht wissen. Das kann ich natürlich verstehen.“ Verständnis zu signalisieren kann oft ein Türöffner sein. „Besonders wichtig ist dabei, Respekt zu zeigen und den Patienten nicht zu belehren, sondern ihn beispielsweise über die Wirkungsweise des Arzneimittels aufzuklären.“
Das gelte auch gegenüber demjenigen Patienten, der einfach raus und zurück auf die Arbeit will – auch von denen gibt es nämlich viele. „Wenn ich merke, dass das jemand ist, der schnelle Ergebnisse will, muss ich dem natürlich auch Rechnung tragen.“ Dabei sei es aber wichtig, auch korrigierend einzugreifen, wenn das für den Patienten zum Nachteil gereichen könnte. „Patienten müssen oft daran erinnert werden, sich den Raum zum Gesundwerden zu erlauben. Wenn ich zum Beispiel Ruhe verordnet bekomme, sollte ich nicht erst noch etwas im Garten erledigen. Da können auch Apotheker die Patienten unterstützen und sie darauf hinweisen.“
Allerdings können Apotheker hier oft auch als Korrektiv fungieren. Khaschei führt es aus: „Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr auf Außensteuerung beruht. Tracking von Gesundheitsdaten ist symptomatisch dafür. Das verringert aber gleichzeitig die Selbstwahrnehmung, denn eigentlich ich bräuchte kein Wearable, um zu merken, dass mein Herz beim Joggen schneller schlägt. Wir legen oft mehr Wert darauf, was von außen gemeldet wird, als auf das, was wir selbst fühlen können.“ Deshalb sei es wichtig, ein Gefühl dafür bekommen, welche Selbstwahrnehmung eine Person hat.
Auch zu beachten ist natürlich immer die Aufnahmefähigkeit eines Menschen. Die kann nicht nur durch Gesundheitszustand und Alter, sondern auch durch die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt sein. „Wenn ich einen jungen Patienten habe, der sich nur den Arm gebrochen hat, kann ich ihm die Informationen natürlich sehr viel komprimierter aufbereiten, als einer alten Dame mit Fieber.“ Bei kognitiv beeinträchtigten Menschen wiederum sei es wichtig, die Barrierefreiehit der Informationen sicherzustellen: Kurze Sätze mit Subjekt, Prädikat, Objekt, kurze, klare, nicht verschachtelte Sätze und eventuell sogar eine Broschüre mit Zeichensprache. „In beiden Situationen geht es darum, dass das Extrakt der Information beim Gegenüber ankommt.“
Ist der Hauptteil des Gespräches geschafft, kommt aber immer noch eine entscheidende Situation. Aus der Gedächtnisforschung gebe es die Erkenntnis, dass Informationen, die am Ende eines Gespräches vermittelt werden, besser im Gedächtnis bleiben. Dasselbe gelte für Gefühle. „Deshalb ist es immer sehr hilfreich einen positiven Gesprächsabschluss zu finden.“ Dazu zählen nicht nur nette Worte wie „Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen“ oder „Ich hoffe ich konnte Ihre Fragen beantworten“. Besonders gut könne man am Gesprächsende ein positives Gefühl vermitteln, wenn man sich auf die konkrete Situation des Patienten einstellt: „Ich hoffe, ihre Kopfschmerzen sind bald vorbei“, beispielsweise oder „Ich hoffe, Sie können heute Abend wieder besser schlafen.“



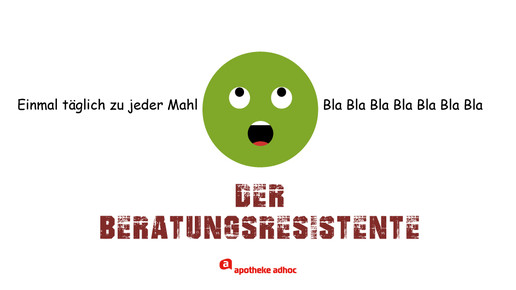

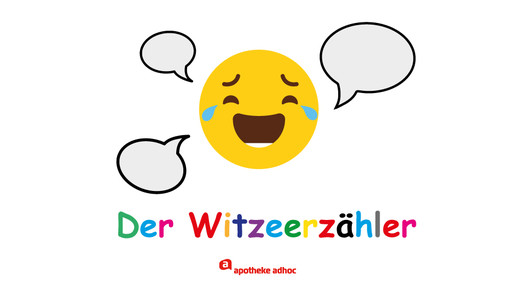
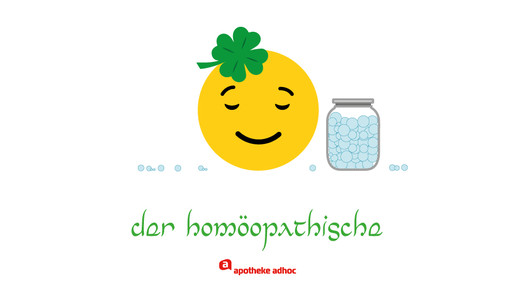

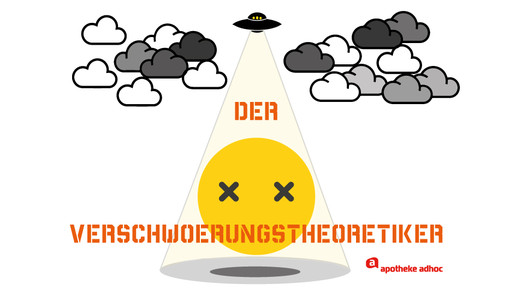
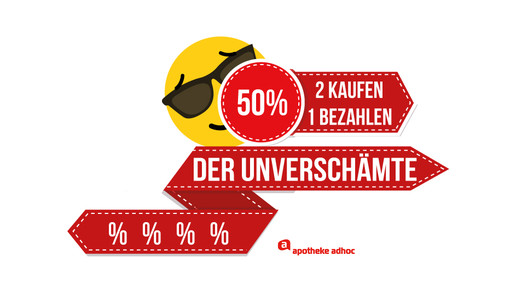

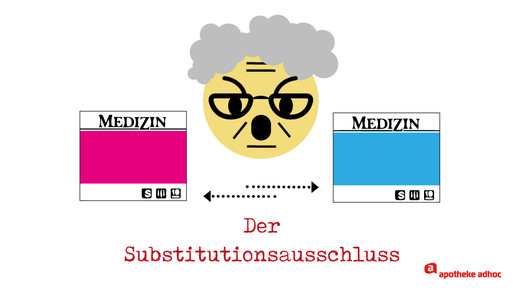





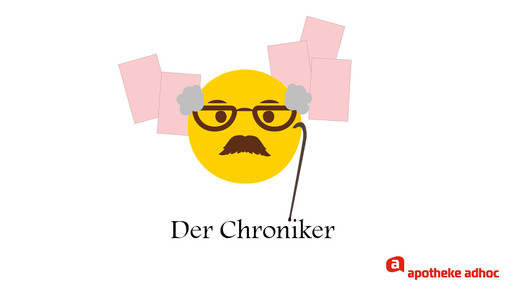










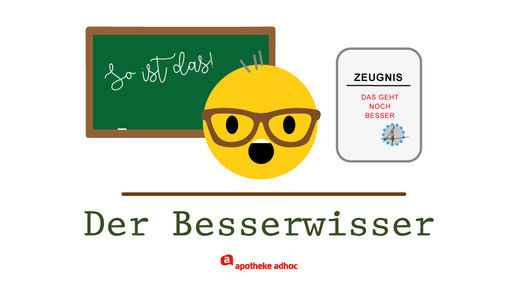
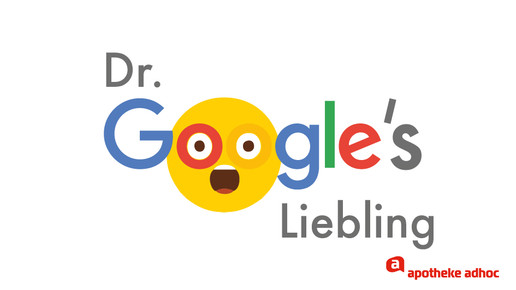



















APOTHEKE ADHOC Debatte