Fresh-up: Pufferlösungen
Bei allen wasserhaltigen Zubereitungen der Rezeptur ist es wichtig, auf den pH-Wert zu achten. Werden Wirkstoffe verarbeitet, die nur bei einem bestimmten sauren oder basischen Milieu ihre Löslichkeit oder Stabilität beibehalten, ist es nötig, eine Pufferlösung einzusetzen. Doch welche Puffer gibt es überhaupt? Darf man sie einsetzen, auch wenn sie nicht auf der ärztlichen Verordnung stehen? Wie wähle ich sie aus?
Wie der Name schon sagt, dient der Puffer in der Rezeptur sozusagen als „Knautschzone“ und fängt sowohl Säuren als auch Basen durch seine spezielle Zusammensetzung ab. Der pH-Wert der Rezeptur ändert sich aufgrund der Pufferzugabe nicht wesentlich, so dass der enthaltene Wirkstoff stabil bleibt und die Laufzeit sich nicht verkürzt. Chemische Puffer finden sich überall in der Natur, auch im menschlichen Organismus – vor allem im Blut – gibt es verschiedene Puffersysteme. In der Rezeptur bestehen sie üblicherweise aus einer schwachen Säure und ihrer korrespondierenden Base im Verhältnis 1:1.
In der Apotheke gibt es vor allem vier wichtige Puffer, die häufig in Rezepturen eingesetzt werden: den Lactat-Puffer, den Citrat-Puffer – beide bei pH 4,2 – und den Phosphat-Citrat-Puffer, der bei pH 5 abpuffert. Diese drei Systeme befinden sich im leicht sauren Bereich. Der Phosphat-Puffer lässt sich dagegen auf verschiedene Werte einstellen. Um einen leicht basischen Bereich von 7,2 zu erreichen, benötigt man für die Herstellung 25 Prozent 0,2 M Kaliumdihydrogenphosphat-Lösung, 17,5 Prozent 0,1 N Natriumhydroxid-Lösung und 57,5 Prozent Wasser. Er wird, außer für harnstoffhaltige Rezepturen, eher selten benötigt.
Welche Puffer sich für welche Rezeptur eignen, kann sehr verschieden sein und von mehreren Faktoren abhängen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich am Neuem Rezeptur-Formularium (NRF) zu orientieren, wenn dort eine standardisierte Rezeptur mit dem gewünschten Wirkstoff und der passenden Grundlage zu finden ist. Häufig werden sie bei selbst zusammengestellten Rezepturen von den Ärzten nicht auf der Verordnung aufgeführt. Dann gilt § 7 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO). Dieser regelt, dass Ausgangsstoffe ergänzt werden dürfen, sofern sie keine eigene arzneiliche Wirkung haben und die arzneiliche Wirkung nicht nachteilig beeinflussen können.
Der Lactat-Puffer wird im NRF ausschließlich für die Stabilisierung von Harnstoff in wasserhaltigen Zubereitungen benutzt. Die standardisierten Rezepturen finden sich bei NRF 11.71 bis 11.74. Er besteht, bezogen auf die Gesamtmasse der Zubereitung, aus einem Teil Milchsäure 90 Prozent und 4 Teilen Natriumlactat-Lösung 50 Prozent. Bei freien Rezepturen findet sich dieser Puffer auch in Vaginalgelen. Der Citrat-Puffer findet seinen Einsatz bei NRF 11.37 und 11.76. Er wird für Mometasonfuorat, Betamethason-17-valerat, Dexamethason und Clobetasol-17-propionat genutzt. Dieses System besteht aus je 0,5 Prozent Citronensäure und Natriumcitrat in gereinigtem Wasser. Dadurch ist es mikrobiell anfällig und muss für jede Rezeptur entweder frisch hergestellt oder mit 20 Prozent Propylenglycol haltbar gemacht werden. Konserviert ist der Puffer sechs Monate lang verwendbar.
Der Phosphat-Citrat-Puffer kommt bei besonders problematischen Wirkstoffen wie Triclosan und Metronidazol zum Einsatz. Er besteht aus zwei Stammlösungen, nämlich 0,1 M Citronensäure-Lösung und 0,2 M Dinatriumphosphat-Lösung. Diese Stammlösungen A und B können im Verhältnis zueinander so variiert werden, dass sowohl ein stark saurer, wie auch ein basischer Bereich eingestellt werden kann. Typisch ist eine Pufferung bei pH 5 mit 4,85 ml A und 5,15 ml B. Auch hier können 20 Prozent des Wasseranteils durch Propylenglycol ersetzt werden. Oder der Puffer wird mit 0,14 Prozent Kaliumsorbat ersetzt.
Grundsätzlich gilt die Faustregel, dass etwa 5 Prozent der Gesamtmasse der Rezeptur durch einen Puffer ersetzt wird, damit er seine optimale Wirkung entfalten kann. Werden die Lösungen auf Vorrat hergestellt, so empfiehlt es sich, mindestens ein Herstellungsprotokoll dazu zu verfassen. Einige Pharmazieräte vertreten sogar die Auffassung, dass es sich hierbei um eine Defektur handelt, die entsprechend gekennzeichnet und protokolliert werden muss. Es sollte bei jedem Zusatz von Pufferlösungen jedoch zuerst die Frage der Verträglichkeit für den Patienten gestellt werden. Ob ein Pufferzusatz überhaupt notwendig ist, steht oft erst nach einer Überprüfung des pH-Wertes der fertigen Rezeptur fest.






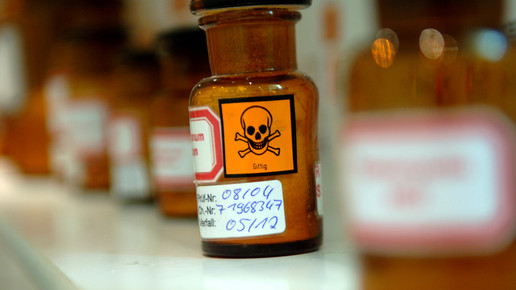
























APOTHEKE ADHOC Debatte